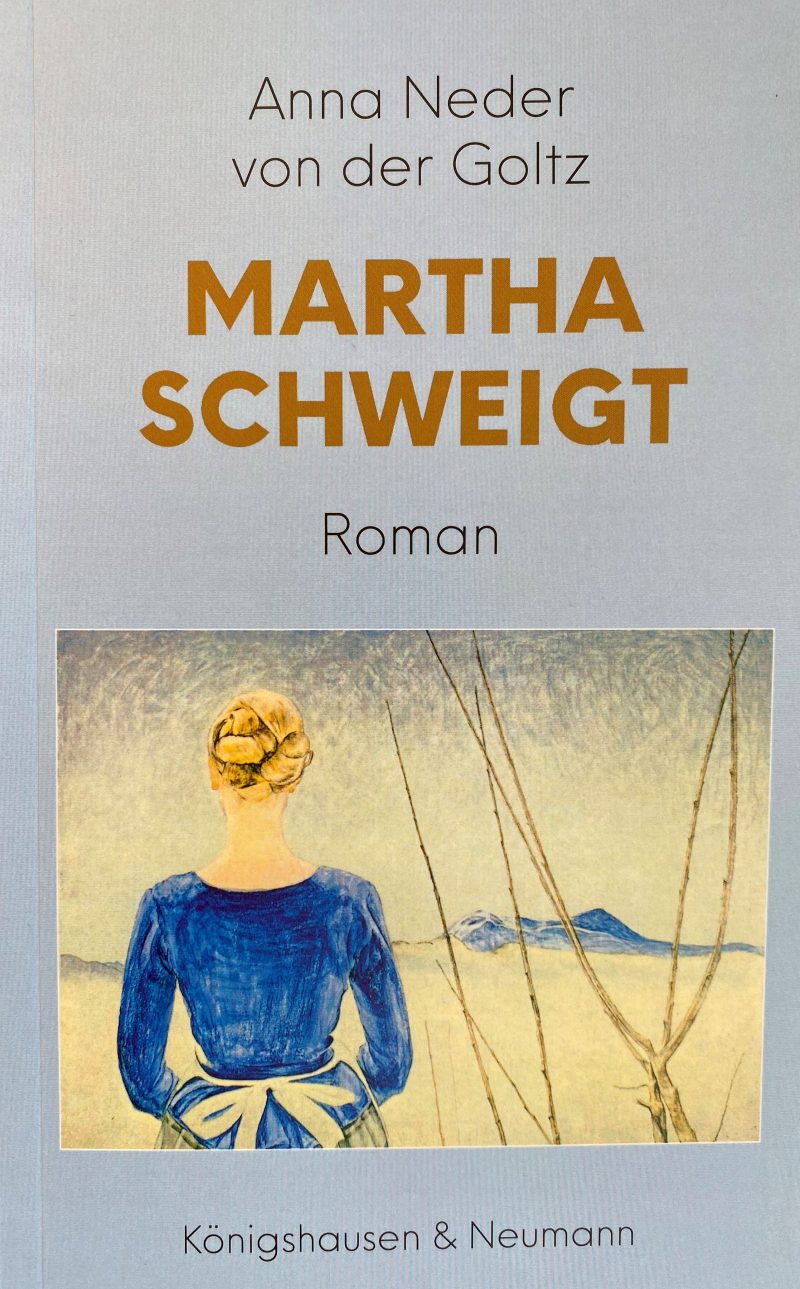1955
Ich hätte das Dorf nicht verlassen dürfen, dachte sie, ich hätte niemals fortgehen sollen.
Noch immer hielt Martha den Brief fest in ihren Händen. Sie trat ans Fenster und schaute in Richtung Westen, dort wo ihr Dorf in fünfzig Kilometer Entfernung lag. Ihr Blick schweifte über die Dächer der Stadt. Der Kirchturm von Sankt Josef, der sie an ihren Heimatort erinnerte und dessen Glockentöne stündlich in e-fis-gis-h-cis ertönten, hatte ihr so oft Trost gespendet, vor allem dann, wenn ihr Heimweh sie überwältigte.Anstelle der Dächer stellte sie sich manchmal weite Felder und Wiesen mit blühenden Bäumen vor, im Mai weiß, im Sommer rot, voll mit Kirschen und im Herbst voller gelber Äpfel.
Wie gerne wäre sie hinausgerannt, barfuß über die Wiesen gelaufen, so wie sie es oft als Kind getan hatte – doch es lag das vierstöckige Treppenhaus dazwischen und unten angekommen, bot sich die Natur, wenn sie die Tür ins Freie öffnete, nur als kümmerlicher, von Hecken begrenzter Stadtpark an. Und der Wald, viel zu weit weg, um ihn zu Fuß zu erreichen und ihm die Sorgen hinaustragen zu können.
Sie starrte erneut auf das Dokument. Ihr Name war auf der Besitzurkunde eingetragen. Das Haus gehörte ihr. Das schönste Haus im Dorf, aus Buntsandstein, mit Garten und Obstbäumen darin, umgeben von einer alten Steinmauer.
Er hatte es ihr vermacht. Ausgerechnet er.
1 Träume 1945
In den Fenstern der Bergstraße Nummer acht brannte noch Licht bis tief in die Nacht. Man musste siebenundfünfzig Stufen zum Haus hochsteigen. Martha zählte jedes Mal die Treppenstufen und nahm immer zwei gleichzeitig. Ihre Mutter klagte über das wackelige Holzgeländer und befürchtete, dass ihre porösen Knie und das Geländer irgendwann gleichzeitig einbrechen könnten. Die Haustür hing schief in den Angeln, so dass der Wind an den Ecken hindurch-wehen konnte. Die Holzfarbe an den Fensterläden blätterte ab und der Lehmputz bröckelte von den Wänden und legte die Stützbalken frei, so dass sie schutzlos Sturm und Regen ausgeliefert waren. Das kleine baufällige Haus wartete vergeblich auf den Mann, der dies alles reparieren, wiederherrichten würde, denn der Krieg hatte ihn vor langer Zeit verschluckt.
Edwin, einer der beiden Nachbarjungen, trug das Brennholz hinauf. Sein Vater hatte sich beim letzten Fronturlaub in der Scheune erhängt und nun verdienten sich die beiden Jungen durch Holzsammeln etwas dazu. Marthas Mutter nähte für Edwins Mutter und die Söhne und bekam Milch, Kartoffeln und manchmal auch Kohl dafür.
„Meinst du, der Vater kommt wieder heim?“, fragte Mutter jeden Abend, während sie den Lampenschirm bis zur Tischplatte hinunterzog, um beim Stopfen besser sehen zu können. Martha blieb ihr jedes Mal die Antwort schuldig.
Bis spät in die Nacht saßen die beiden Frauen am Küchentisch. Sie hatten zuvor einen Topf Milch auf dem Herd erhitzt, in den die Mutter Honig hineinrührte, bevor sie ihre Stopfsachen aus der Tischschublade holte und anfing, mit dicker Wolle und Stopfnadel die Löcher zu schließen. Martha war über Papierbögen gebeugt, die sie für ein Schnittmuster auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Sie wollte das Fräulein in der Schule beeindrucken und musste die ganze Zeit daran denken, welche Augen es machen würde, wenn sie ihr die Plisseefalten, die sie gelegt und geheftet hatte, zeigen würde.
Aus den alten Mänteln und Jacken ihres Vaters hatte sie schon Flanellröcke genäht und aus dem restlichen Vorhangstoff Sommerkleider für sich und die Mutter.
Die Mutter strickte, meist aus aufgetrennter Wolle, für die Leute im Dorf. Und im Rhythmus der Stricknadeln, mit denen sie den Faden führte, fing sie an, Geschichten von früher zu erzählen: Vom Schorsch, der so jung verunglückt war, vom Ferdinand mit dem Klumpfuß, von der Erna, die auf die höhere Schule geschickt worden war, von der Antonia …
„Mama, ich will auch auf die höhere Schule gehen“, unterbrach Martha den Erzählstrom ihrer Mutter.
„Was du dir net einbildest“, sagte die Mutter, als sie von ihrer Handarbeit hochschaute, „da muss man doch g’scheit sein?“
„Ich bin g’scheit“, antwortete Martha trotzig, „das Fräulein lässt mich oft mit den jüngeren Kindern rechnen und lesen und fragt, ob ich den großen Mädchen an der Nähmaschine helfen kann.“
Die Augen der Mutter wirkten müde, als sie zu ihrer Tochter aufsah. „Martha, treib dir die Flausen aus dem Kopf, wer soll denn die Arbeit daheim machen?“
Sie bauten Gemüse im Garten an und jeden Herbst legten sie gestampftes Sauerkraut und Soleier in große Tontöpfe ein, kochten aus Fallobst Apfelmus und aus Himbeeren und Walderdbeeren Marmelade. Die Kräuterkunde für die Dorfschulklasse fand oft in ihrem Garten und im nahegelegenen Wald statt, wo Martha die Exkursion für die Schulkinder leiten durfte.
„Mutter, ich bin die Beste in der Schule, ich kann alles aus dem Heimatkundeheft auswendig aufsagen:
Der rote und der weiße Main
fließen westlich von Kulmbach zusammen.
Bald ist Lichtenfels erreicht,
rechts auf steiler Höhe steht Schloss Banz, …“
„Still, Martha, sei still“, unterbrach die Mutter sie. „Bete lieber ein Gegrüßet seist du Maria oder ein Vater unser, damit der Herrgott seine Hand über unser Haus hält.“
„Das ist doch kein Haus, Mutter, das ist eine Bruchbude!“, entgegnete Martha ihr zornig.
„Versündige dich nicht, Kind“, ermahnte die Mutter sie.
„Wenn ich Lehrerin wäre, könnten wir im Schulhaus wohnen, Mama, wär das nicht schön?“
Doch die Mutter hatte den Kopf schon wieder über ihre Handarbeit gebeugt.
Am nächsten Morgen konnte Martha es kaum erwarten, in die Schule zu kommen, denn heute würde sie dem Fräulein ihr Plissee Kleid zeigen. Sie holte ihr Fahrrad aus dem Schuppen, klemmte ihr Kleid, das sie in Packpapier eingewickelt hatte, auf dem Gepäckträger fest und fuhr mit ihrem Schulranzen auf dem Rücken los. Während der ganzen Fahrt musste sie an ihre Plisseefalten denken, die sie dieses Mal oben im Brustteil eingenäht hatte, damit ihr Busen größer wirken würde. Mit einem weißen Spitzenkragen darauf wollte sie es zu ihrem Vorstellungsgespräch in der Hauswirtschaftsschule anziehen und hoffte, dass man fragen würde, ob sie das Kleid selbst genäht hatte.
Sie lehnte ihr Rad an die alte Buntsandsteinmauer des Schulhauses, kein Schüler saß mehr auf der Treppe. Bin ich zu spät?, dachte sie erschrocken, und da niemand im Flur zu sehen war, fing sie an zu rennen. Als sie an der offenen Klassentüre stand, sah sie den Lehrer am Fenster stehen – er war aus dem Krieg heimgekehrt. Alle Kinder saßen schon auf ihren Plätzen und eine seltsame Stille lag wie ein bleierner Nebel über dem Raum.
„Guten Morgen, Herr Lehrer“, grüßte Martha vorsichtig, und als keine Antwort kam, ging sie verängstigt auf ihren Platz.
„Aufstehen!“, befahl der Lehrer, nachdem die Schulglocke geläutet hatte. Anton schlug beim Aufstehen seine beiden Schuhe fest aneinander und streckte reflexartig seine Hand zum Hitlergruß nach vorne.
Der Lehrer, der zwei Stufen erhöht auf dem Pult stand, ignorierte ihn und ließ ein lautes Grüß Gott über die Köpfe der Dorfschulkinder erschallen.
„Grüß Gott, Herr Lehrer“, kam es im Chor zurück.
Beim Morgengebet waren alle Blicke auf das Kreuz gerichtet, das über dem Lehrer hing, dort, wo vorher das Hitlerbild gehangen hatte und von dem nur noch die vergilbten Ränder übriggeblieben waren. Martha fragte sich mit Bangen, wo denn das Fräulein geblieben sei. „Setzen“, ordnete der Lehrer an und schickte Martha sogleich mit den jüngeren Kindern zum Rechnen in den hinteren Teil des Klassenzimmers. Während die Kleinen versuchten durch Abzählen einzelner Finger ihre Rechenaufgaben zu lösen, war Martha in Gedanken bei dem Fräulein. Auch wenn sie zwischendurch die Kinder daran erinnerte, doch immer zwei, drei oder fünf Perlen gleichzeitig am Abakus weiterzuschieben, damit sie die Lösung schneller finden würden, konnte sie die Gedanken nicht loslassen.
Als der Lehrer die Überschrift Unser Getreide an die Tafel schrieb und Edwin bat, die Ähren von Weizen, Roggen, Hafer und Gerste an die Tafel zu zeichnen, merkte Martha, dass sie das alles nicht interessierte. Erst nach dem Schlussgebet, zu dem sie sich mühsam erhoben hatte, spürte Martha wieder Leben in sich aufkommen, als der Lehrer bekannt gab, dass das Fräulein morgen zu Hauswirtschaft und Handarbeit kommen werde, während er die Buben in Handwerken und Technischem Zeichnen unterrichten werde. Ihr „Auf Wiedersehen, Herr Lehrer“ klang wie ein Freudenruf.
Martha sprang die letzten Steinstufen vor dem Schulhaus hinunter. Sie wollte Edwin einholen, der in der gleichen Bankreihe saß wie sie, nur der Gang, der Jungen und Mädchen im Schulzimmer trennte, lag zwischen ihnen, auch er wollte auf die höhere Schule gehen. Edwin wollte Arzt werden und konnte jetzt schon alles auf Latein aufsagen, was er durch seinen Ministrantendienst in der Kirche mitbekommen hatte und wofür ihn Martha bewunderte.
„Edwin“, rief sie ganz außer Atmen, als sie am Schultor angelangt war, wo sie ihn zusammen mit Anton einholte. „Gehst du nächstes Jahr in die Oberschule?“
„Wieso, wer will des denn wissen?“, fragte Edwin misstrauisch.
„Meine Mutter“, log Martha, „sie lässt fragen, ob sie Hemden vom Vater für dich umnähen soll?“
„Weiß nicht“, murmelte Edwin verlegen.
„Ach, da is’ jemand hinter unserem zukünftigen Doktor her“, spöttelte Anton, und Martha spürte, wie sie rot anlief.
„Ich brauch keinen Herrn Doktor, ich will selbst Lehrerin werden!“, gab Martha trotzig als Antwort zurück.
„Oh, da will jemand was Besseres werden“, reizte Anton sie weiter. „Lehrerin willst du werden?“, mischte sich Edwin jetzt ein, „wieso denn?“
„Es ist nur die Hauswirtschaftsschule, ich kann im Schwesternhaus wohnen und am Samstag fahr ich mit meinem Fahrrad heim zur Mutter und am Sonntag wieder zurück“, sagte Martha fast atemlos.
„Na, wenn da mal der Herr Lehrer nicht auf den Tisch haut“, stieß Anton hervor und als Martha Edwin verwirrt ansah, erklärte der: „Paul war auch gescheit, und trotzdem hat der Lehrer ihn nicht auf die höhere Schule gelassen. Die Tüchtigen sollen daheim im Dorf bleiben, soll er gesagt haben.“
Jeder wusste, dass es Widerrede beim Lehrer nicht geben durfte. Auf der Fahrt nach Hause trat Martha so fest in die Pedale, wie sie es nie zuvor getan hatte. Sie musste ihrem Zorn und ihrer Wut über das Gehörte freien Lauf lassen. Und als sie durch die Gartentür zum Haus hochlief, schwor sie mit festem Blick zum Himmel, dass sie sich niemals für ihr Vorhaben schämen würde.
2 Kinderspiel
Immer ging er irgendwo verloren, immer musste er ihn suchen. „Schau, wo dein kleiner Bruder ist“, sagte die Mutter zu Edwin, „du musst auf ihn achten, jetzt wo der Vater nicht mehr da ist.“
Er fand ihn oft auf den langgezogenen Gartenbeeten, unten am Ortsausgang, oder weiter draußen am Waldrand auf den Kartoffelfeldern, lange nachdem schon alle nach Hause gegangen waren. Er stand allein vor dem versengten Kartoffelkraut, aus dem noch leichte weiße Rauchschwaden emporstiegen, wühlte mit einem an der Spitze verkohlten Stock im Haufen und suchte nach weichen Kartoffelstücken oder nach Resten von geröstetem Hasenbrot. Edwin sah ihn schon von weitem, mit seinen krummen Beinen, ganz hinten am Ende des Feldes stehen. Wie klein er war, dachte Edwin, während er die Ackerfurchen entlang zum Feldrand hinlief; nie kam dieser schnell genug den anderen hinterher und die knöchelhohen Schuhe, meist eine Nummer zu groß und mit Nägeln beschlagener Sohle, trugen nicht dazu bei, dass sein Gang sich beschleunigte und er nicht mehr abgehängt werden konnte.
Das Wetter war ungemütlich, der Himmel trüb und es hatte zu nieseln angefangen. Edwin, bei seinem Bruder angekommen, beugte sich zu ihm hinunter, löste den Stock aus der klammen Kinderhand, wischte mit dem Hemdsärmel über dessen Rotznase, hob ihn hoch, setzte ihn seitlich auf seine Hüfte und hielt ihn mit dem Arm fest umschlungen. Leo legte sein blasses sommersprossiges Gesichtchen an die Halsmulde seines großen Bruders und stieß einen tiefen Seufzer aus, so als ob er schon darauf gewartet hätte, dass Edwin ihn sicher nach Hause bringen würde.
Abends, wenn es dämmerte und die Mutter nach Leo rief, erschrak Edwin jedes Mal, weil er Angst hatte, dass er irgendwann zu spät kommen würde und Leo ertrunken sei, in der gefüllten Regentonne, wo der Bruder kleine Rindenstücke als Schiffchen fahren ließ, oder im Dorfweiher, wo er mit den anderen Buben nach Molchen fischte, während Edwin mit seiner Mutter die Feld- und Hofarbeit machte. Die Kinder wateten im hüfthohen, grünlich schlickigen Gewässer und schöpften die kleinen Tierchen in Dosen und Gläser, um sie mit nach Hause nehmen und beobachten zu können, wie sie sich in Frösche verwandelten. Doch meist verschüttete Leo die aufgefangene Wassermenge schon beim Hinausklettern auf den moosig glitschigen Stufen der Holztreppe am Weiherrand oder stolperte und ließ das Glas fallen, während er auf der holprig steinigen Dorfstraße nach Hause lief. Mutter war jedes Mal froh, wenn er sich dabei nicht geschnitten hatte, doch Edwin war verärgert darüber, dass sein Bruder nicht besser aufpassen konnte und dass er seit Vaters Tod allein für Mutter und Leo verantwortlich war.
Der Vater hat uns im Stich gelassen, dachte er wütend, wenn er wieder mal auf der Suche nach seinem kleinen Bruder war. Wenn er nur wie jeder andere hier im Dorf im Krieg gefallen wäre, dann könnte ich wenigstens stolz auf meinen Vater sein. Die alten Bauern im Dorf würden ihm anerkennend und ehrfürchtig beim Totengedenken zunicken, wohl wissend, was es bedeutete im Krieg gewesen zu sein und Frauen und Kinder allein mit der Verantwortung für Haus und Hof zurückzulassen. Die Frauen würden ihm tröstend auf die Schulter klopfen und ihm bestätigen, wie wichtig er für seine Mutter, die Arbeit auf dem Hof und auch für seinen kleinen Bruder sei. Doch er bekam weder die Achtung der Männer noch den Zuspruch der Frauen und auch nicht die Anerkennung der jungen Burschen oder vaterlosen Kinder im Dorf. Es wurde einfach geschwiegen. Das Schweigen zog sich wie eine unsichtbare Mauer um seine Mutter, seinen Bruder, ihn und den kleinen Hof.
Letzten Samstag suchte er Leo wieder einmal. Nachdem er an einigen Kartoffeläckern entlanggelaufen war, am Dorfweiher geschaut hatte und bei den Türen anderer Eltern geklopft und die Kinder gefragt hatte, ob sie wüssten, wo Leo sei, ob sie ihn gesehen oder mit ihm zusammengespielt hätten, und nur Kopfschütteln und Schulterzucken geerntet hatte, stellte er genervt und wütend zugleich die Suche ein. Er beschloss nach Hause zu gehen, in der leisen Hoffnung, dass Leo schon dort aufgetaucht wäre.
Die Abendstille hatte sich über das Dorf gelegt und der Mond zog mit hellblassem Licht herauf. Als Edwin die Hoftür öffnete und sich noch einmal zum Dorfplatz umdrehte, sah er über der Steinmauer des Nachbarhofes im matten Licht der Straßenlaterne einen röt-lichen Haarschopf in den Zweigen des Baumes schimmern. Er stürzte wie ein Irrer auf die Mauer zu, stemmte sich hoch und lief auf dem Mauersims zu Leo hin, der dort mit Stricken an einem Baum fest-gebunden war. Um das Kinn baumelte lose eine Schlinge. Edwin schleuderte diese von Leos Kopf über den Ast hinweg, schrie so laut er konnte den Namen seines Bruders, sprang von der Mauer herun-ter, während sein Schreien immer schriller wurde, und versuchte mit den Fingern die Verknotungen des Seils zu lösen, während er weinend und laut schluchzend immer wieder „Leo“ rief und ihn dabei ohrfeigte.
Die Hoflampe ging an und der alte Bauer Brehm trat, vom Schreien alarmiert, vor die Tür. Als er die beiden Brüder sah, schob er seine Frau, die ebenfalls herausgetreten war, zur Seite, stürzte in die Küche und kam mit einem scharfen Hornmesser zurück, lief zu Edwin hin und half ihm die festen Stricke zu durchtrennen. Leos Körper rutschte am Baumstamm herunter und Edwin schlug erneut in das kleine blasse Gesicht, in der Hoffnung, dass sein Bruder zu sich kommen würde. Er kniete sich hinunter zu dem kleinen leblosen Körper und hievte ihn über seine Schulter und als er aufstand, hielt ihm der alte Bauer den Arm zur Stütze hin und murmelte dabei: „Um Gottes willen, warum denn schon wieder auf meinem Hof, warum denn schon wieder auf meinem Hof?“
Mutter stand mit angsterfülltem Blick am Tor, beide Hände an den Mund gelegt, während die alte Bäuerin Brehm in den Hof rannte, einen Eimer kaltes Wasser aus der Regentonne schöpfte und über Leos Gesicht goss, bevor Edwin mit ihm über die Türschwelle des Hauses trat. Die alte Brehm herrschte die Mutter an, die immer noch erstarrt am Tor stand, ihr beim Tragen des Holzzubers in die Küche zu helfen. Sie stellten ihn neben den Herd, in dem das Feuer loderte. Und während diese abwechselnd, heißes Wasser aus dem Herd-bassin und kaltes aus dem Hahn in den Zuber schöpfte, streiften Edwin und die Mutter Leos Kleider ab. Sie setzten ihn in das Warm-wasserbad, massierten ihm dabei seine kalten und blutleeren Füße und Hände und die Mutter küsste und drückte immer wieder sein Gesichtchen, bis Leo schließlich die Augen öffnete und mit heiserer Stimme stammelte: „Mama, ich bin kein Verräter.“ Nicht nur Edwin und die Mutter erschraken bei diesen Worten, sondern auch die alte Bäuerin Brehm, denn sie sagte plötzlich unnötig laut, sie habe noch Hühnerbrühe bei sich auf dem Herd stehen und wolle sie für Leo holen.
„Das würde ihm sicher guttun“, sagte sie und verließ hastig das Haus. Edwin wurde das Gefühl nicht los, dass sie geflüchtet war vor Leos Worten, die dieser wiederholte, als Mutter sagte: „Nein, du bist kein Verräter, wer sagt denn so was?“
„Die anderen Kinder wollten, dass ich der Verräter bin“, antwortete Leo mit immer noch heiserer Stimme.
„Aber nein, du Dummerchen, du bist doch kein Verräter, das war doch nur im Spiel“, beschwichtigte die Mutter erneut.
„Und Papa, war der ein Verräter?“, brach nun ein lautes Schluchzen aus Leo heraus, als die Tür aufging und die alte Brehm mit dem Suppentopf hereinkam.
Die Mutter schüttelte den Kopf, tätschelte die Wangen von Leo und sagte: „Ach, du mein kleines Dummerchen!“ Während die Mutter mit einer Hand den Kopf von Leo hielt und mit der anderen weiterhin seine Hände und Füße massierte, löffelte die alte Brehm die Suppe in Leo hinein. Dabei wiederholte sie, wie bei den Fürbitten in der Kirche, immer wieder die Worte: „Das wird dich stark machen, Bub, so stark wie deinen großen Bruder.“
Edwin spürte, dass er nicht mehr gebraucht wurde, und nach den Fragen von Leo wollte er nur weg aus der Küche, hoch in seine Schlafstube. Er setzte sich auf das Bett, schaute zum Fenster in das gelbe Mondlicht hinaus, das wie eingefroren seine Gedanken an den Vater festhielt. Mein Vater ist ein Verräter, ein Feigling, dachte er, fiel seitlich auf das Bett, schleuderte seine Schuhe in die Ecke, legte sich mitsamt seinen Kleidern unter die Bettdecke und fror die ganze Nacht. Die alte Brehm war in dieser Nacht bei Mutter im Haus geblieben. Sie hatten Leo ins Ehebett gelegt, mit Wärmflaschen und dicken Wolldecken umgeben und kalten Wickeln um Hals und Stirn, um die Schwellungen zurückzudrängen.
Die beiden Frauen saßen noch lange in der Küche zusammen, wobei die alte Brehm erzählte, dass einmal ein Kind bei ihnen auf dem Hof zu Tode gekommen sei. Geschubst von einem anderen Kind beim Verstecken- und Fangenspielen vor ihrem Haus und dabei in die Jauchegrube gefallen. Viel zu spät zog ihr Mann damals den kleinen Reinhold aus der Brühe. Seitdem war ein Geländer an der Treppe zwischen Haustür und Misthaufen angebracht worden und ihr Mann verjagte die Kinder, wenn sie auf der Mauer herumkletterten oder wenn er sie im Hof spielen sah. Und vielleicht auch, weil er wusste, dass sein Sohn bei diesen Spielen auch dabei gewesen war.
Es war das erste Mal seit dem Selbstmord des Vaters, dass jemand anderes als der Pfarrer in ihr Haus gekommen war und irgendwie war Edwin froh darüber.